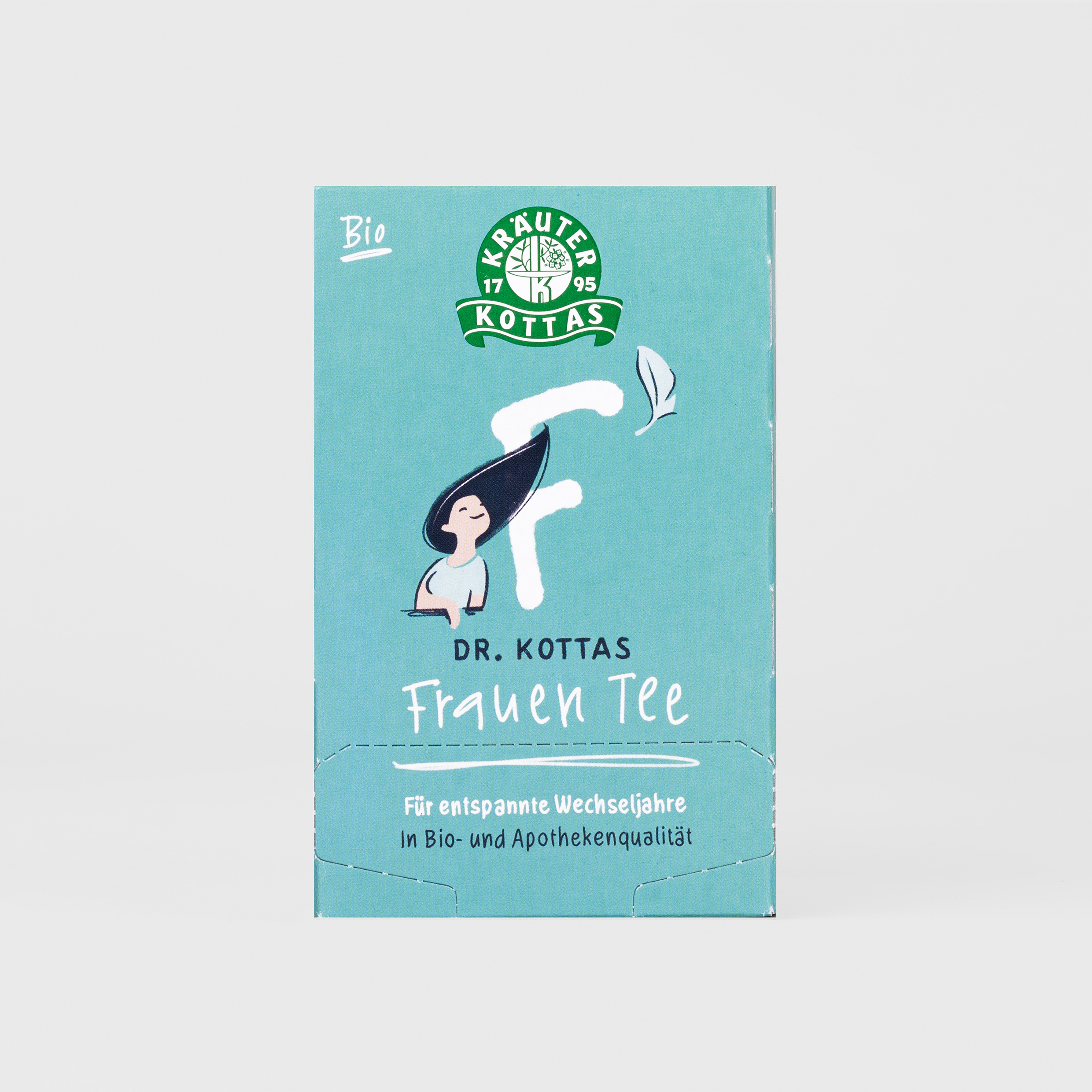Frauen in der europäischen Naturheilkunde

Ihr Leben und Wirken
Seit jeher zeichnen sich Frauen durch ihre besondere Affinität zur Naturheilkunde aus. Schon in der frühen Geschichte traten sie als Ärztinnen und Heilerinnen in Erscheinung. Ein formelles Medizinstudium blieb ihnen über lange Zeit verwehrt, doch sie fanden Wege, ihr Wissen über die Heilkraft der Natur zu erweitern und zum Wohle ihrer Mitmenschen einzusetzen. Diese Frauen waren oft die Hüterinnen des traditionellen Kräuterwissens, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie nutzten die Kraft von Pflanzen, um Krankheiten und Beschwerden zu behandeln, und verbanden spirituelle Praktiken häufig mit natürlichen Heilmethoden.
In diesem Beitrag stellen wir fünf Frauen aus unterschiedlichen Epochen der europäischen Geschichte der Naturheilkunde vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der jüngeren Vergangenheit, da über das Leben der Frauen in früheren Zeiten nur wenige Informationen verfügbar sind. Eine Ausnahme bildet Hildegard von Bingen, die wohl bekannteste Vertreterin der Naturheilkunde, deren Werk und Wirken wir ebenfalls kurz beschreiben werden. Die hier vorgestellten Frauen stehen stellvertretend für viele weitere, die mit ihrem Wissen und ihrer Hingabe die Naturheilkunde geprägt und weiterentwickelt haben.
Schwester Bernardine
(1902 – Sterbejahr unbekannt)
Geboren als Elisabeth Rieffel im elsässischen Colmar, wuchs die spätere Franziskanerschwester in ländlicher Umgebung und ärmlichen Verhältnissen auf. Nach dem frühen Tod der Mutter lebte sie ab dem neunten Lebensjahr bei ihrem verwitweten Großvater und dessen unverheirateten Söhnen. Als einzige Frau im Haus übernahm das junge Mädchen eigenständig den Haushalt. In Ermangelung eigener Spielsachen machte es die Natur zu seinem Spielplatz.
Der Großvater verbrachte viel Zeit mit seiner Enkelin im Freien. An den Sonntagen zeigte er ihr verschiedene Wildkräuter und Pflanzen und erzählte ihr alles, was er über deren Heilwirkungen wusste. Bald begann das Mädchen, selbst Pflanzen anzubauen und sich mit Rezepturen zu beschäftigen. Mit zunehmendem Alter wurde es von Nachbarn immer häufiger um medizinischen Rat gebeten. Schließlich begann es, Kranke zu besuchen. Mit 21 Jahren trat Schwester Bernardine in ein Franziskanerkloster ein. Ab 1925 war sie als Gemeindeschwester an verschiedenen Orten im Elsass tätig.
Schwester Bernardine erlangte in den 1980er-Jahren als Autorin mehrerer Bücher über Hausmittel und Heilkräuter Bekanntheit. In diesem Zusammenhang trat sie mehrfach in bundesdeutschen Medien auf und gab Tipps sowie Informationen zur Naturheilkunde. Dabei betonte sie stets, dass ihre Ratschläge keinesfalls einen Arzt ersetzen könnten. Ihr Credo lautete: „Gegen jede Krankheit hat der Herrgott auch ein Kraut geschaffen.“ Die vielen Rezepturen – von denen nicht alle heute noch von Fachleuten empfohlen werden – beziehen sich nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten und Beschwerden. Sie entwickelte zudem Kräutermischungen für die Pflege von Händen, Füßen, Gesicht und Körper.
Hildegard von Bingen
(1098–1179)
Die wohl prominenteste Frau in der Geschichte der europäischen Naturheilkunde war die Ordensfrau und Mystikerin Hildegard von Bingen. Sie war eine der ersten Persönlichkeiten, für die bereits 1228 ein Heiligsprechungsverfahren eingeleitet wurde. In den Kanon der Heiligen wurde sie im 16. Jahrhundert aufgenommen.
1098 wurde sie als jüngstes von zehn Kindern in Bermersheim in Rheinhessen geboren. Ihre Eltern gehörten dem niederen Landadel an und schickten das Mädchen bereits im Alter von acht Jahren zur Nonnengemeinschaft von Kloster Disibodenberg, wo es eine klösterliche Ausbildung erhalten sollte. Eine Verwandte, die Priorin Jutta von Sponheim, wurde fortan zu Hildegards Lehrmeisterin. Mit 16 Jahren entschied sich das Mädchen, fortan als Nonne zu leben und dem Benediktinerorden beizutreten.
Mit 38 Jahren wurde Hildegard zur Äbtissin gewählt und gründete 1148 ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. In etwa zu dieser Zeit begann sie, eigene naturwissenschaftliche und medizinische Aufzeichnungen zu führen. Ihre neun Bände umfassende Physica ist nach dem Vorbild anderer Naturenzyklopädien strukturiert und enthält unter anderem detaillierte Beschreibungen der Tier- und Pflanzenwelt. Sie befasst sich darin mit rund 500 Heilpflanzen, die sie als gottgegebene Heilmittel bezeichnete. Das zweite zentrale Werk der Hildegard von Bingen ist Causae et Curae („Ursachen und Heilung“), in der sie die Grundlagen einer ganzheitlichen Medizin für Körper, Geist und Seele darlegt.
Bis zu diesem Zeitpunkt stand vor allem das Kurieren von Krankheiten im Fokus der mittelalterlichen Medizin. Neuartig am kräuterheilkundlichen Ansatz der Hildegard von Bingen war, dass auch die Vorbeugung von Krankheiten berücksichtigt wurde. In diesem Zusammenhang gab sie Anregungen im Hinblick auf eine gesunde, maßvolle und ausgewogene Ernährung.
Von ihren Schriften, die Hildegard von Bingen allesamt in lateinischer Sprache verfasst hat, sind heute lediglich Abschriften, jedoch keine Originalaufzeichnungen mehr vorhanden. Obwohl einige Ratschläge nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen, ist das Interesse am gesamten Werk der Mystikerin und Naturheilkundlerin bis in die Gegenwart sehr groß.
Grete Flach
(1897–1994)
Dora Margarethe Anna Mayer, die spätere „Kräutermutter“ Grete Flach, wurde in Stich (Sudetenland, Bezirk Stríbo) geboren und wuchs mit ihren vier Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof auf. Die wichtigsten Bezugspersonen in ihren frühen Lebensjahren waren die Großeltern. Ihr Großvater, ein heilkundiger Schäfer, und ihre analphabetische Großmutter vermittelten ihr ein umfangreiches Erfahrungswissen über die heilende Kraft von Pflanzen, das in der Familie seit Generationen weitergegeben worden war.
Die junge Grete Flach erwies sich als herausragende Schülerin. Nach dem Abschluss der Mittelschule mit 14 oder 15 Jahren wurde sie auf Initiative des Schulleiters direkt als Werkstudentin an der botanischen Fakultät der Prager Karlsuniversität aufgenommen. Ihr Ziel war es, die botanischen Namen der Kräuter zu erlernen, die sie bis dahin nur im Dialekt benennen konnte, um Fachliteratur zu publizieren. Tagsüber arbeitete sie in den Gewächshäusern und im botanischen Garten, abends widmete sie sich dem Studium.
Nach dem Tod des Vaters kehrte sie mit 22 Jahren zurück in ihre Heimat, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner August Jäger erhielt sie dort 20 Jahre lang den landwirtschaftlichen Betrieb. In dieser Zeit begann sie, Menschen mit verschiedenen Beschwerden zu behandeln. Während des Zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die medizinische Versorgung zunehmend und Heilkräuter wurden oft zur einzigen verfügbaren Behandlungsmethode.
Als Sudetendeutsche wurde Grete Flach schließlich nach Hessen vertrieben. Nach dem Tod ihres Partners ließ sie sich in Büdingen nieder, wo sie einen großen Kräutergarten anlegte. Mit den dort kultivierten Heilpflanzen behandelte sie dort ohne offizielle Profession bis zu ihrem Tod 1994 angeblich bis zu 400.000 Menschen.
Katharina Kepler
(1547/1550–1622)
Die Mutter von Johannes Kepler wurde entweder 1547 oder 1550 als Katharina Guldenmann in Eltingen bei Leonberg geboren. Ihr Vater war Wirt und sie arbeitete in ihrer Kindheit und Jugend im familiären Betrieb mit, eine Schule hatte das Dorf zu dieser Zeit nicht. Aufgrund der Krankheit der Mutter lebte sie zeitweilig auch bei einer Verwandten namens Renate Streicher, die das Mädchen mit Kräutern vertraut machte und später als „Hexe“ verbannt wurde. In ihrer Kindheit und Jugend erwarb Katharina Kepler umfassende Kenntnis des Tier- und Pflanzenreichs sowie andere Fertigkeiten, die für das Leben einer unermüdlichen Ehefrau und Mutter zu dieser Zeit als notwendig erachtet wurden.
1571 kam es zur Eheschließung mit Heinrich Kepler, sieben Monate später wurde der gemeinsame Sohn Johannes geboren. Die Ehe war unglücklich, doch Katharina Kepler brachte in den folgenden Jahren sechs weitere Kinder zur Welt und zog mehrfach um. Nach dem Tod ihres Mannes sowie ihres verwitweten Vaters war sie durch beträchtliche Erbschaften finanziell unabhängig.
Bedeutung für die Naturheilkunde erlangte sie nicht durch ihr Werk oder Wirken, sondern durch ihr tragisches Schicksal – eines, das stellvertretend für viele sogenannte „Kräuterfrauen“ (Herberia) steht. Die fleißige Frau, die Kräuteressenzen zur Heilung bestimmter Beschwerden und Krankheiten mischte, sah sich ab 1615 mit dem Vorwurf der Hexerei konfrontiert. Der Auslöser: Eine Nachbarin hatte nach der Einnahme eines von ihr zubereiteten bitteren Tranks über Beschwerden geklagt. Die inzwischen betagte Katharina Kepler wurde daraufhin verhaftet und vor Gericht gestellt. Im Zuge des daraufhin folgenden Hexenprozesses hielt sie jahrelanger Folter und Haft stand. Mit der Unterstützung ihres berühmten Sohnes konnte sie 1621 einen Freispruch erwirken.
Maria Schlenz
(1881–1946)
In einem gänzlich anderen Bereich der Naturheilkunde wirkte die Österreicherin Maria Schlenz, die 1881 in Reisnitz geboren wurde. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schulrat Rudolf Schlenz, lebte sie in Innsbruck. Über ihre Jugend und ihren Werdegang ist wenig bekannt.
1920 entwickelte Maria Schlenz das später nach ihr benannte „Schlenzbad“. Dabei handelte es sich um ein Vollbad, bei dem die Temperatur zunächst der Körpertemperatur entspricht, jedoch nach und nach auf maximal 40 Grad erhöht wird. Zunächst orientierte sie sich stark an den Schriften von Sebastian Kneipp, später ergänzte sie ihre Überwärmungsbäder durch die Beigabe von Kräutern und Salz.
Ab 1945 wurden Schlenzbäder an der Innsbrucker Universitätsklinik durchgeführt – unter Leitung von Maria Schlenz' Sohn, dem Arzt Josef Schlenz (geboren 1920). Nach dem Tod seiner Mutter überarbeitete dieser deren Werk und veröffentlichte 1956 die Schrift namens „Die Schlenzkur“. In der modernen Naturheilkunde gelten Überwärmungsbäder heute als etablierte Behandlungsmethode zur Immunmodulation und in anderen Anwendungsfällen. Da es jedoch zahlreiche Kontraindikationen gibt, sollten sie ausschließlich unter klinischer Aufsicht angewendet werden.
Quellen:
Bingen, Hildegard von (2022): Das große Buch der Hildegard von Bingen. Bewährtes Heilwissen für Gesundheit und Wohlbefinden. Köln: Naumann & Göbel.
Fagner, Annabelle & Tilmann Schempp (2007): Kräuterwissen weiser Frauen. Ostfildern: Thorbecke.
Greiner, Karin & Weber, Angelika (1999): Magie und Heilkraft der Frauenkräuter. München: Mosaik.
Kerckhoff, Annette (2020): Wichtige Frauen in der Naturheilkunde. Ihr Leben – ihr Werk – ihre Schriften. Berlin: Springer.
Rublack, Ulinka (2018): Der Astronom und die Hexe. Johannes Kepler und seine Zeit. Stuttgart: Klett-Cotta.
Freyung 7
A-1010 Wien
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:30 - 18:00
Sa 9:00 - 12:30
Telefon +43 1 533 9532
Eitnergasse 8
A-1230 Wien
Freyung 7
A-1010 Wien
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:30 - 18:00
Sa 9:00 - 12:30
Telefon +43 1 533 9532
KOTTAS PHARMA GmbH - Firmenzentrale
Eitnergasse 8
A-1230 Wien
STANDORT & KONTAKT
APOTHEKEN
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ