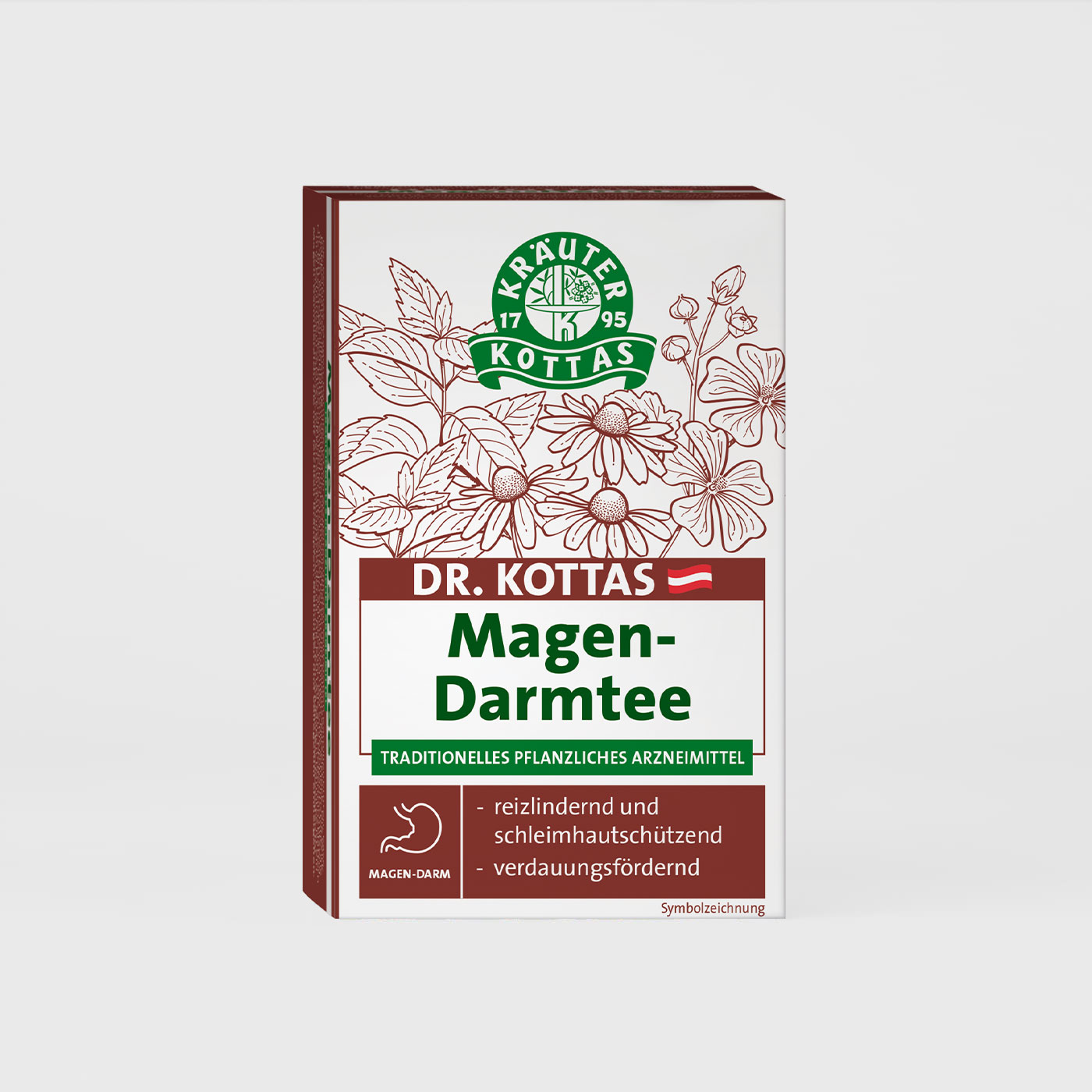Kräuter für Magen & Darm

Pflanzliche Mittel für die Verdauung
Wer kennt das nicht? Ein flaues Gefühl im Magen, Bauchschmerzen oder andere Verdauungsprobleme. Meist sind eine falsche Ernährung, Infekte oder Stress die Auslöser. Doch erfreulicherweise hält die Natur eine Fülle an heilkräftigen Helfern bereit: Heilkräuter können bei vielen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich Linderung verschaffen und eine gestörte Verdauung wieder ins Gleichgewicht bringen.
In diesem umfassenden Ratgeber stellen wir Ihnen pflanzliche Hausmittel für verschiedene Arten von Verdauungsproblemen vor. Ziel dieses Beitrags ist es, eine erste Orientierung über die zahlreichen wohltuenden Kräuter für Magen und Darm zu bieten. Die erste Adresse bei Problemen mit Magen und Darm ist allerdings Ihr Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin. Bei starken und anhaltenden Beschwerden sollten Sie sich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben.
Kamillenblüten (Chamomillae flos)
Vorkommen:
Die Echte Kamille (Matricaria recutita) ist ein Korbblütengewächs, das ursprünglich in Süd- und Osteuropa sowie Vorderasien beheimatet war. Heute findet sie sich vorzugsweise an Wegrändern, verwilderten Plätzen oder Schutthalden in ganz Europa und sogar in Nordamerika sowie Australien. Zusätzlich wird Kamille für den Arznei- sowie Lebensmittelbereich in einigen Ländern der Welt in Kulturen angebaut.
Wirkung und Anwendung:
Bei Bauchschmerzen und Beschwerden des Magen-Darm-Trakts gilt Kamillentee als das Hausmittel schlechthin. Die dafür verwendeten Blüten der Kamille, die zwischen dem dritten und fünften Tag nach dem Aufblühen der Pflanze geerntet werden, sind reich an ätherischem Öl, Flavonoiden und Schleimstoffen. Sie wirken dadurch entzündungshemmend, blähungstreibend und entkrampfend. Das ebenfalls arzneilich genutzte ätherische Kamillenöl ist aufgrund des enthaltenen Chamazulen blau gefärbt.
In vielen Fällen sorgt Kamillenblütentee* für Linderung bei krampfartigen Schmerzen, wie sie etwa beim Reizdarm- oder Reizmagensyndrom auftreten können. Hinzu kommen die antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften der Kamillenblüten, die den Tee bei verschiedenen Infektionen wirksam machen. Ferner wird der gemeinhin gut verträgliche Tee zur Behandlung von Entzündungen der Haut eingesetzt.
Kümmelfrüchte (Carvi fructus)
Vorkommen:
Der sogenannte Echte Kümmel (Carum carvi) ist ein Doldenblütengewächs und gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt. Die ausdauernde Pflanze spielte im altertümlichen Brauchtum eine bedeutende Rolle. Sie zählt zu den häufigsten wilden Gewürzpflanzen Mitteleuropas und gedeiht auf Wiesen und Weiden in ganz Europa.
Wirkung:
Die würzig-aromatischen Kümmelfrüchte werden zwischen Juli und September noch vor der Vollreife geerntet und enthalten zwischen 3 und 7 % an ätherischem Öl. Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Phenolcarbonsäuren sowie Flavonoide. Kümmel gilt als das stärkste bekannte pflanzliche Karminativum (blähungstreibendes Mittel) und hat sich als gut verträglich erwiesen. Medizinisch wird gerne das aus den Früchten gewonnene Kümmelöl genutzt, das für gewöhnlich äußerlich angewendet wird.
Anwendung:
Bei flatulenzbedingten Koliken bei Kleinkindern werden kümmelhaltige Tees oder Öle zur äußeren Anwendung empfohlen. Oft findet sich Kümmel auf den Zutatenlisten von Tees für Kinder und Babys, wie beispielsweise in unserem DR. KOTTAS Bio-Babytee oder auch im DR. KOTTAS Bio-Stilltee (für stillende Mütter).
In einigen Kombinationspräparaten und in der Küche kommt dem aromatischen Kümmel die Funktion des Geschmackskorrigierens zu.
Süßholzwurzel (Liquiritiae radix)
Vorkommen:
Süßholz (Glycyrrhiza glabra) ist ein Schmetterlingsblütler und zeichnet sich durch eine weit zurückreichende Anwendungstradition aus. Das langlebige Gewächs ist vom östlichen Mittelmeerraum über Kleinasien bis in den Iran und Zentralasien heimisch. Es wächst bevorzugt auf sandigen, lehmigen Böden und an grasigen Plätzen. Für die Gewinnung der Arzneidroge wird Süßholz in verschiedenen Ländern wie in China, Russland, Italien oder der Türkei kultiviert.
Wirkung:
Medizinisch genutzt wird die Süßholzwurzel, die schwach riecht und – wie der Name erahnen lässt – einen süßen Geschmack aufweist. Als Lakritze wird der aus den getrockneten Wurzeln gewonnene dicke Saft bezeichnet. Die Süßholzwurzel weist einen hohen Anteil an Triterpensaponinen, hauptsächlich Glycyrrhizin, auf. Sie ist für ihr breites Wirkprofil bekannt, dokumentiert wurden zum Beispiel entzündungshemmende, krampflösende, schleimhautschützende und antibakterielle Effekte.
Anwendung:
Häufig findet Süßholzwurzel bei Erkrankungen des Magens und des Zwölffingerdarms arzneilich Verwendung. Bei Krämpfen infolge einer Gastritis, Dyspepsie oder eines Reizmagens kann die Arzneidroge Abhilfe schaffen. Als Zutat findet sie sich beispielsweise in unserem DR. KOTTAS Sodbrennentee*. Trotz der zahlreichen positiven gesundheitlichen Effekte der Süßholzwurzel ist bei der Einnahme in gewissen Fällen Vorsicht geboten. Wer zum Beispiel unter Bluthochdruck leidet oder schwanger ist, sollte sich diesbezüglich unbedingt mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin absprechen.
Pfefferminzblätter (Menthae piperitae folium)
Vorkommen:
Die Pfefferminze (Mentha × piperita) gehört zur Familie der Lippenblütler und ist das Ergebnis der Kreuzung verschiedener Minzearten. Minzen zählen zu den ältesten Gewürzen und Heilpflanzen und werden in der Kulinarik, der Lebensmittel- und Kosmetikherstellung wie im medizinischen Bereich seit langem genutzt. Als Hybrid kann die Pfefferminze nur durch Stecklinge in Kulturen vegetativ vermehrt werden. Nähere Informationen zur Pflanze und ihrer Geschichte finden Sie in unserem Blogbeitrag zur Pfefferminze.
Wirkung:
In der Medizin kommen vorrangig die Blätter der Pfefferminze zum Einsatz. Sie enthalten viel ätherisches Öl mit den Hauptbestandteilen Menthol und Menthon sowie wertvolle Phenolcarbonsäuren und Flavonoide. Als erwiesen gilt ihre krampflösende, blähungstreibende und galletreibende Wirkung. Ihr aromatischer Geschmack bewirkt eine Stimulation der Galle-, Speichel- und Magensaftsekretion, wodurch sie appetitanregend und verdauungsfördernd wirkt.
Anwendung:
Die positiven gesundheitlichen Effekte der Pfefferminzblätter auf den Magen sind maßgeblich auf das enthaltene Menthol sowie die Flavonoide zurückzuführen. Bei Übelkeit und Brechreiz ist Pfefferminze das Mittel der Wahl, überdies wird sie bei Oberbauchbeschwerden und Krämpfen im Magen- und Darmbereich eingesetzt.
Aber Vorsicht: Personen mit Reflux (Sodbrennen) sollten besser auf Pfefferminze verzichten und auf andere pflanzliche Mittel zurückgreifen.
In der Lebensmittelindustrie wird Pfefferminze auch als Aromakomponente, etwa in verschiedensten alkoholischen Getränken, Limonaden oder Sirupen verwendet.
Käsepappelblätter (Malvae folium)
Vorkommen:
Als wahrer Allrounder unter den Heilpflanzen präsentiert sich die Wilde Malve (Malva sylvestris) oder Käsepappel. Das ausdauernde Malvengewächs ist in Europa, Westasien und Nordafrika verbreitet und wächst bevorzugt an Wald- und Wegrändern, Hecken und unbebauten Flächen. Seit der Antike werden die Blätter und Blüten der Pflanze medizinisch sowie als Nahrungsmittel genutzt.
Wirkung:
Als Herba omnimorbium – „Kraut gegen alle Krankheiten“ – wurde die Malve im alten Rom für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften geschätzt. Reich an Schleimstoffen, Flavonoiden und Gerbstoffen zeichnen sich die Käsepappelblätter durch ein breites Anwendungsspektrum aus. Mit ihrer schleimhautschützenden, reizlindernden und antibakteriellen Wirkung können sie bei unterschiedlichsten Beschwerden des Magen-Darm-Traktes helfen.
Anwendung:
Zubereitungen mit Käsepappelblättern haben sich insbesondere bei Gastritis oder Reizmagen als effektiv erwiesen. Bei diversen Schleimhautreizungen, etwa im Mund- und Rachenbereich, wirkt die Arzneidroge beruhigend. Aufgrund der guten Verträglichkeit sind Malvenblätter Bestandteil zahlreicher Teerezepturen wie dem DR. KOTTAS Magen-Darmtee*.
Daneben werden die Blüten der Malve medizinisch genutzt. Abgesehen von Schleimstoffen und anderen Inhaltsstoffen weisen sie wertvolle Anthocyane auf, darunter das entzündungshemmend wirkende Malvin. Jedoch werden sie eher bei Husten sowie Heiserkeit als bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt.
Melissenblätter (Melissae folium)
Vorkommen:
Eine weitere Vertreterin aus der Familie der Lippenblütengewächse ist die Melisse oder Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Das langlebige und ausdauernde Gewächs stammt ursprünglich aus Westasien bzw. dem östlichen Mittelmeergebiet, wird aber seit Jahrhunderten in weiten Teilen Europas als Heilpflanze kultiviert. Seit dem Mittelalter ist die Melisse in der europäischen Volksheilkunde als beruhigendes und verdauungsförderndes Arzneimittel bekannt.
Wirkung:
Die zitronig-mild schmeckenden und duftenden Blätter der Melisse werden noch vor der Blüte im Juni geerntet. Sie enthalten wertvolles ätherisches Öl, Hydroxyzimtsäurederivate mit Rosmarinsäure als Hauptkomponente, Flavonoide und Triterpene. Durch das ätherische Öl wirken sie entkrampfend und blähungstreibend – diese Eigenschaften kommen bei funktionellen Magen-Darm-Beschwerden zum Tragen.
Anwendung:
Bei akuter Gastritis hat sich die Behandlung mit Melissentee* oder anderen Zubereitungen aus Melissenblättern als hilfreich erwiesen. Überdies findet das hochwirksame Melissenöl speziell im Rahmen von Aromatherapien Verwendung. In seiner Reinform ist dieses aus Kostengründen kaum erhältlich, stattdessen werden unter der Bezeichnung „Indisches Melissenöl“ sich ähnlich zusammensetzende Öle verkauft.
Tausendguldenkraut (Centaurii herba)
Vorkommen:
Das variantenreiche Tausendguldenkraut (Centaurium erythraea) oder Tausendgüldenkraut ist ein Vertreter der Familie der Enziangewächse. Die zahlreichen Arten wachsen zerstreut in ganz Europa, werden aber nach Norden hin seltener. Weiters ist die Gattung in Nordafrika, im westlichen Asien sowie in Nordamerika beheimatet. In Österreich gilt die traditionelle Heilpflanze als gefährdet. Daher wird sie meist aus Südosteuropa importiert, wo sie klimabedingt deutlich häufiger vorkommt und noch vorwiegend wild gesammelt wird.
Wirkung und Anwendung:
In vergangenen Zeiten wurde Tausendguldenkraut in Europa als verdauungsförderndes Mittel bei Magenschwäche eingesetzt. Geschmack und Wirkprofil der ein- bis zweijährigen Pflanze werden erheblich durch die enthaltenen Secoiridoidglykoside, vorrangig das antibakteriell wirkende Swertiamarin und Swerosid, bestimmt. Konkret sieht das Europäische Arzneibuch hierbei einen Bitterwert von über 2.000 vor. Ein für Wirkung und Geschmack entscheidender hoher Bitterwert wird nur erreicht, wenn ein hoher Anteil an Blüten vorliegt.
Die Bitterstoffe fördern die Freisetzung von Magensaft und Speichel und wirken auf diese Weise appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei Appetitlosigkeit und dyspeptischen Beschwerden kann der leicht bitter schmeckende Tausendguldenkrauttee* unterstützend wirken. In der Volksmedizin ist Tausendguldenkraut als generelles Stärkungs- und Kräftigungsmittel im Einsatz.
Kalmuswurzelstock (Calami rhizoma)
Vorkommen:
Kalmus (Acorus calamus) gehört zur Familie der Kalmusgewächse und kommt ursprünglich aus Südasien. Die Sumpfpflanze ist mittlerweile in vielen Regionen der nördlichen Hemisphäre eingebürgert und verwildert, darunter Mitteleuropa und Nordamerika.
In der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und im Ayurveda hat Kalmus als Heilpflanze mit breitem Anwendungsspektrum eine lange Tradition. Ebenso wurde es von den indigenen Völkern Nordamerikas medizinisch genutzt.
Wirkung und Anwendung:
Charakteristisch für dieses Gewächs ist das am Boden entlang wachsende Rhizom, das arzneilich von Bedeutung ist. Dieses wird im September und Oktober geerntet und anschließend getrocknet. Es enthält wertvolle Bitterstoffe und ätherisches Öl, Glykoside, Schleimstoffe sowie Gerbstoffe.
Vor allem findet der Kalmuswurzelstock bei Appetitlosigkeit sowie bei nervös bedingten Magen-Darm-Beschwerden Verwendung. Er weist eine kräftigende, entkrampfende und reizlindernde Wirkung auf und wird deshalb etwa bei Blähungen, Magengeschwüren oder Gastritis empfohlen. Üblicherweise findet sich Kalmus in Kombinationspräparaten oder Teemischungen gemeinsam mit anderen verdauungsfördernden Kräutern. Aus dem Rhizom wird ferner Kalmusöl hergestellt, das medizinisch und in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.
Heidelbeeren (Myrtilli fructus siccus/recens)
Vorkommen:
Bei der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) handelt es sich um einen bis zu 60 cm hohen Zwergstrauch aus der Familie der Heidekrautgewächse. Seit frühesten Zeiten wurden die Bestandteile der Pflanze zu medizinischen Zwecken genutzt. Von den zahlreichen Sorten ist ausschließlich die europäische Heidelbeere als Arzneipflanze geeignet. Die im Lebensmittelbereich erhältlichen Kulturheidelbeeren stammen hingegen nicht von dieser, sondern in der Regel von nordamerikanischen Sorten wie der Amerikanischen Heidelbeere (Vaccinium corymbosum) ab.
Wirkung und Anwendung:
Verwendet werden die getrockneten und frischen Früchte. Getrocknete Beeren weisen einen hohen Anteil an Gerbstoffen von 5 bis 12 % auf. Dadurch wirken sie adstringierend, stopfend und antiseptisch. Gut geeignet sind sie zur Behandlung von Durchfallerkrankungen, gerade bei kleinen Kindern bzw. bei der Säuglingsdyspepsie.
Heidelbeeren sind zum Beispiel Bestandteil von unserem DR. KOTTAS Bio-Süße Träume-Tee für Kinder ab dem vierten Lebensmonat. Unser DR. KOTTAS Heidelbeertee enthält zusätzlich entkoffeinierten Schwarztee (mehr zur Wirkung des Schwarztees später!) und ist aus diesem Grund für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet.
Frische Heidelbeeren enthalten bis zu 0,3 % Anthocyane, die Schale und Fruchtfleisch ihre Farbe verleihen und denen eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird. Darüber hinaus finden Blätter der Heidelbeere als Arzneimittel Verwendung, eine offizielle Monografie der Europäische Arzneibuchkommission gibt es bislang keine. Volksmedizinisch werden sie als Tee bei Durchfall oder Nierenbeschwerden empfohlen.
Fenchelfrüchte (Foeniculi fructus)
Vorkommen:
Zur Familie der Doldenblütler gehörend, ist der Fenchel (Foeniculum vulgare) im Mittelmeerraum heimisch. Inzwischen wird die anspruchslose Pflanze ebenso in Feldkulturen in Mitteleuropa und am Balkan angebaut. Sie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 2,5 m und bildet gelbe Blüten mit 10- bis 20-strahligen Dolden. Die zweiteiligen Spaltfrüchte des Süßen und Bitteren Fenchel werden seit Jahrtausenden zu medizinischen Zwecken verwendet. Sie werden Ende Oktober oder Anfang November geerntet und sind überaus aromatisch.
Wirkung:
Fenchelfrüchte sind reich an ätherischem Öl mit Komponenten wie trans-Anethol, Fenchon und Estragol. Beim Bitteren Fenchel liegt der Anteil zwischen 3 und 8, 5 %, die Früchte des Süßen Fenchels enthalten 0,8 bis 3 % ätherisches Öl. In erster Linie wirken Fenchelfrüchte entblähend, weiters weisen sie krampflösende, antimikrobielle und antioxidative Eigenschaften auf.
Anwendung:
Bei Magen-Darm-Beschwerden mit Krämpfen werden Zubereitungen mit Fenchel gerne empfohlen. Insbesondere bei starken Blähungen kann Fencheltee lindernd wirken. Sowohl Fenchelöl als auch Fenchelfrüchte sind bei Dyspepsie und Durchfall im Säuglingsalter zu empfehlen. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind leichte Krämpfe im Zuge der Menstruation.
Schwarztee (Theae nigrae folium)
Vorkommen:
Die Teepflanze (Camellia sinensis) stammt ursprünglich vermutlich aus den subtropisch-feuchten Bergregionen im Grenzgebiet des heutigen Myanmar und China. Das schattenliebende Teestrauchgewächs wächst an schattigen Plätzen im Unterholz immergrüner Wälder und wird bereits seit vielen Jahrhunderten kultiviert. Unter anderem haben der Anbau von Tee und das Teetrinken in China, Japan, Indien, Sri Lanka und anderen Teilen Ostasiens lange Tradition.
Schwarzer Tee wird wie Grüner Tee aus den Blättern des Teestrauchs hergestellt. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Teearten liegt im Herstellungsprozess. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserem Blogbeitrag zum Teestrauch. Bei der Herstellung von Schwarztee oxidieren die Blätter vollständig und färben sich dunkel.
Wirkung und Anwendung:
Schwarztee ist reich an Gerbstoffen und wird darum bei Durchfallerkrankungen empfohlen. Kurz gezogen wirkt Schwarzer Tee anregend, nach längerer Ziehzeit lösen sich schließlich die Gerbstoffe. Der stimulierende Effekt nimmt wieder ab und der antidiarrhoische Effekt setzt ein. Wer Schwarztee zur Linderung von Durchfallbeschwerden trinkt, sollte den Tee etwa 10 Minuten lang ziehen lassen.
Wichtig: Personen mit empfindlichem Magen sollten längere Ziehzeiten vermeiden, da die Gerbstoffe und Chlorogensäure Beschwerden verursachen können. Zudem wird von einer gleichzeitigen Einnahme mit Medikamenten abgeraten, ein zeitlicher Abstand von mindestens 2 Stunden ist empfehlenswert.
Korianderfrüchte (Coriandri fructus)
Vorkommen:
Ein weiterer Vertreter aus der Familie der Doldenblütler ist der ursprünglich in Vorderasien beheimatete Koriander (Coriandrum sativum). Durch Verschleppung ist dieser gelegentlich auch in Südeuropa, Nordafrika sowie in Regionen Nord- und Südamerikas verwildert anzutreffen. In Europa wird arzneilich verwendeter Koriander unter anderem in Ungarn, Bulgarien, der Ukraine und Russland angebaut.
Wirkung und Anwendung:
Als eines der ältesten Gewürze der Welt wurde der Koriander schon in alten Sanskritschriften erwähnt. Im Altertum wurde er beispielsweise als Wurmmittel eingesetzt, die medizinische Verwendung bei Verdauungsbeschwerden ist in verschiedensten Kulturkreisen dokumentiert. In der europäischen Volksheilkunde wurde der Koriander ab dem 9. Jahrhundert als Mittel zur Stärkung des Magens genutzt.
Die Früchte des Korianders enthalten zwischen 0,1 bis 2 % ätherisches Öl mit Linalool als Hauptkomponente, das auch für den aromatischen Geruch verantwortlich ist. Sie zeichnen sich durch blähungstreibende, leicht krampflösende und antibakterielle Eigenschaften aus. Außerdem regen sie den Speichelfluss sowie die Magensaftsekretion an. Des Weiteren sind etwa rund 20 % fettes Öl, Phytosterole, Flavonoide sowie Vitamin C in den Korianderfrüchten enthalten. Arzneilich werden Rezepturen mit Korianderfrüchten sowie Korianderöl bei Blähungen, dyspeptischen Beschwerden sowie bei Appetitlosigkeit genutzt. Die Blätter und Früchte der Pflanze weisen antioxidative und antibakterielle Eigenschaften auf.
Sternanisfrüchte (Anisi stellati fructus)
Vorkommen:
Als Vertreter der Sternanisgewächse ist der Echte Sternanis (Illicum verum) mit über 40 Arten ausschließlich in Kulturen anzutreffen. Ursprünglich kommt der kleine, immergrüne Baum wahrscheinlich aus Südchina und Nordvietnam. In Südostasien hat er als Heilpflanze – etwa in China unter dem Namen „Achthörniger Fenchel“ – seit Jahrtausenden Tradition.
Wirkung:
Die Sternanisfrüchte, die dreimal jährlich zur Vollreife geerntet werden, enthalten ätherisches Öl und Flavonoide. Diese Inhaltsstoffe sind für die entkrampfenden und entblähenden Eigenschaften verantwortlich. Der aromatische Geschmack wirkt wiederum appetitanregend und sekretionsfördernd. Bei Blähungen, leichten Krämpfen und dyspeptischen Beschwerden können Sternanisfrüchte lindernd wirken. Im Übrigen haben sie sich als effektives Hausmittel gegen Mundgeruch erwiesen.
Anwendung:
In der TCM (Traditionelle chinesische Medizin) findet Sternanis bei abdominellen Koliken und Übelkeit Verwendung. Gelegentlich wurde er Teezubereitungen zur Behandlung von Schlaflosigkeit und Nervosität beigemischt.
Sternanis ist darüber hinaus fester Bestandteil der chinesischen Küche. So werden seine Früchte im asiatischen Raum zur Förderung der Verdauung vielen Speisen beigemischt. Im 16. Jahrhundert gelangte der Sternanis schließlich nach Europa. Als Gewürz setzte er sich dort erst relativ spät im Laufe des 18. Jahrhunderts durch.
Anisfrüchte (Anisi fructus)
Vorkommen:
Ein weiteres heilkräftiges Doldenblütengewächs ist Anis (Pimpinella anisum). Die einjährige, bis zu 50 cm hoch wachsende Pflanze stammt aus Vorderasien und dem östlichen Mittelmeergebiet. Das aromatische Gewächs ist eine alte Kulturpflanze, die schon in vergangenen Zeiten gerne als pflanzliches Hausmittel gegen Blähungen und andere Beschwerden eingesetzt wurde. In der westlichen Küche ist der aromatische Anis seit jeher ein beliebtes Gewürz, das beispielsweise in diversen Backwaren und Brotmischungen enthalten ist.
Wirkung und Anwendung:
Die charakteristischen Spaltfrüchte der Pflanze weisen einen Gehalt von rund 2 bis 6 % an ätherischem Öl auf. Als blähungstreibendes und entkrampfendes Mittel werden Anisfrüchte bei diversen Magen-Darm-Beschwerden empfohlen, unter anderem bei dyspeptischen und milden spastischen gastrointestinalen Beschwerden, wie Flatulenzen oder Blähungen. Obendrein wirkt Anis antibakteriell und sekretionsfördernd auf Speichel sowie Magensäfte und unterstützt somit die Magenfunktion.
Viele Rezepturen setzen auf eine Kombination aus Anis mit anderen Verdauungskräutern, unser DR. KOTTAS Anis-Fenchel-Tee* enthält neben Anisfrüchten zum Beispiel Fenchel, Kümmel, Koriander und Sternanis.
Ingwerwurzel (Zingiberis rhizoma)
Vorkommen:
Ursprünglich in Ostasien beheimatet, wird der Ingwer (Zingiber officinale) in verschiedenen tropischen Regionen der Welt kultiviert – etwa in China, Indien, Jamaika oder Australien. Bei dem ausdauernden Ingwergewächs handelt es sich um eine bis zu 1 m hohe Staude mit einem schilfartigen Spross und einem kriechend wachsenden und knollig-fleischigen Wurzelstock.
Wirkung und Anwendung:
Seit dem Altertum wird der Ingwerwurzelstock medizinisch genutzt. In der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM) spielt er eine wichtige Rolle, mit seinen scharfen und heißen Qualitäten wird er bei Magenschmerzen eingesetzt. Er enthält 5 bis 8 % Oleoresin – einen zähflüssigen Balsam aus ätherischen Ölen sowie Scharfstoffen (Gingerole und Shogaole). Die Zusammensetzung des enthaltenen ätherischen Öls unterscheidet sich je nach Herkunft, dementsprechend fällt der Geschmack unterschiedlich aus.
Die Wirkungen des Ingwerwurzelstocks gelten als gut belegt. Durch die Erregung der Wärmerezeptoren in der Mundschleimhaut fördert er die Speichel- und Magensaftsekretion und wirkt somit appetitanregend. Aufgrund der enthaltenen Scharfstoffe lindert Ingwer Brechreiz. Ingwertee hat sich beispielsweise als Mittel gegen reisebedingte Übelkeit sowie unterschiedliche Verdauungsbeschwerden bewährt.
Schafgarbenkraut (Millefolii herba)
Vorkommen:
Die Scharfgarbe (Achillea millefolium) ist ein in großen Teilen Europas sowie in Nordasien und Nordamerika verbreitetes Korbblütengewächs mit breitem Wirkungsspektrum. Ihr deutscher Name leitet sich von Beobachtungen im Hinblick auf ebendiese vielfältigen Wirkungen aus dem Tierreich ab: Erkrankte Schafe sollen instinktiv vermehrt das Kraut dieser traditionsreichen Heilpflanze fressen, die mitunter als Blustillkraut oder Bauchwehkraut bezeichnet wurde.
Wirkung und Anwendung:
Als Arzneimittel werden die Blüten und das gesamte Kraut der Gemeinen Schafgarbe genutzt. Die Pflanze enthält reichlich Bitterstoffe, welche für ihre appetitanregenden und sekretionsfördernden Eigenschaften verantwortlich sind. Darum findet sie bei Appetitlosigkeit, dyspeptischen Beschwerden oder Beschwerden der Galle Anwendung. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Schafgarbe ist das ätherische Öl, das antimikrobiell wirkt. Zusätzlich beinhaltet das Kraut relativ viel Kalium, wodurch die Nierentätigkeit angekurbelt werden soll.
Seit langem gilt Schafgarbe zusätzlich als bewährtes Mittel gegen „Frauenleiden“, bei Dysmenorrhöen und anderen gynäkologischen Beschwerden wird Schafgarbentee* oftmals empfohlen. Das Kraut ist in vielen Frauenteemischungen enthalten und wird in der Volksmedizin zur „Blutreinigung“ oder zur Behandlung innerer und äußerlicher Blutungen eingesetzt.
Faulbaumrinde (Frangulae cortex)
Vorkommen:
Beim Faulbaum (Rhamnus frangula) handelt es sich um ein Kreuzdorngewächs, das überall in Europa – bevorzugt an feuchten Waldstellen und Bachufern – gedeiht. Seinen Namen hat der 1 bis 3 m hohe Strauch oder kleine Baum dem Umstand zu verdanken, dass seine Rinde einen unangenehmen, leichten Fäulnisgeruch aufweist. Diese enthält bis zu 8 % Anthrachinonglykoside, Dianthronglykoside sowie Gerbstoffe.
Wirkung und Anwendung:
Mindestens seit dem 16. Jahrhundert ist die natürliche Abführwirkung der Faulbaumrinde bekannt – wie die Aufzeichnungen des Pflanzenheilkundigen Hieronymus Bock belegen. Im Geschmack schleimig-süßlich bis adstringierend-bitter wird sie bei Verstopfungen und Blähungen medizinisch genutzt. So ist sie beispielsweise im DR. KOTTAS Abführtee* enthalten. Gerne wird Faulbaumrinde bei kurzfristigen Erkrankungen und in Situationen verwendet, bei denen weicher Stuhlgang erwünscht ist, zum Beispiel nach rektal-analen Eingriffen oder bei Hämorrhoiden.
Da hierbei einige Kontraindikationen bekannt sind und unerwünschte Wechsel- oder Nebenwirkungen auftreten können, sollte die Einnahme von Rezepturen mit Faulbaumrinde in Absprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin erfolgen.
*Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
Quellen:
Bäumler, S. (2021). Heilpflanzenpraxis Heute. Arzneipflanzenporträts, 3. Auflage, München.
Blaschek, W. (Hrsg.) (2016). Wichtl – Teedrogen und Phytopharmaka: Ein Handbuch für die Praxis, 6. Auflage, Stuttgart.
Unsere Empfehlungen für Magen & Darm
Freyung 7
A-1010 Wien
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:30 - 18:00
Sa 9:00 - 12:30
Telefon +43 1 533 9532
Eitnergasse 8
A-1230 Wien
Freyung 7
A-1010 Wien
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:30 - 18:00
Sa 9:00 - 12:30
Telefon +43 1 533 9532
KOTTAS PHARMA GmbH - Firmenzentrale
Eitnergasse 8
A-1230 Wien
STANDORT & KONTAKT
APOTHEKEN
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ